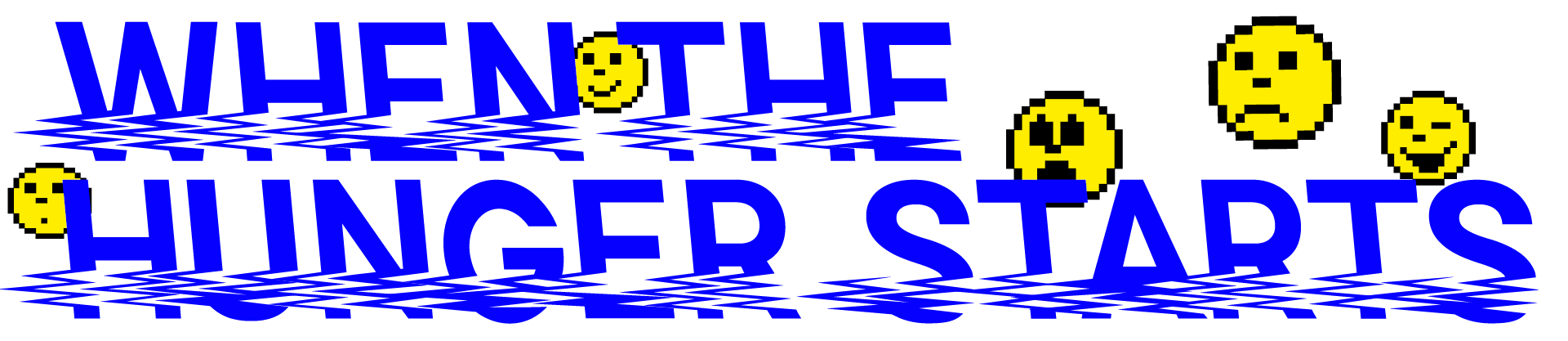Künstlerischer Parasitismus

„Die Stadtratte lädt zum Mahle, auf türkischen Teppichen. Geladen ist die Landratte. Die beiden schmausen und knabbern Ortolanenreste. Es sind nur Reste, was so übrigbleibt von einer Mahlzeit. […] Beim ersten Geräusch an der Tür stieben die beiden Ratten auseinander. Es war nur ein Geräusch, und doch eine Botschaft - wie eine Nachricht, die Panik sät. Letztlich ein Bruch, eine Unterbrechung, eine Störung der Kommunikation. Aber war dies Geräusch wirklich eine Botschaft? War es nicht vielmehr ein Rauschen, ein Parasit? Wer hat hier am Ende das letzte Wort? Wer sät Unordnung, wer stiftet eine neue, andere Ordnung?“ – Der Parasit, Michel Serres, S.11 (1987)
In Berlin unterdessen haben die Ratten es längst raus. Niemals würden sie die allgemeine Akzeptanz ihrer flüchtigen Präsenz durch sowas wie ein gemeinsames Abendessen überstrapazieren. Stattdessen haben sie sich, so wie die vielen anderen rastlosen Existenzen dieser Stadt, das Gebot der Entortung und Flexibilisierung gemein gemacht, ja, in gewisser Weise perfektioniert. Neben entrechteten Mieter*innen und Wohnungslosen, prekär Arbeitenden und Studierenden, sind es Kunst- und Kulturschaffende, die sich notgedrungen eine Scheibe dieser verdorbenen Kompetenz abschneiden, um zu überleben. Denn eloquent anmutende Begriffe, wie das Flüchtige oder das Ephemere, die Aktion oder das Ereignis tarnen oftmals nur den Verlust benutz- und bezahlbarer Räume und die Exklusion aus institutioneller Förderung.
Und doch gelingt einigen dieser parasitären Kunstpraxen die zeitweilige Einnistung in den gesellschaftlichen Körper. Dabei verändern sie nicht nur ihren Wirt, sondern auch sich selbst und können als Träger*innen ambivalenter Eigenschaften gelten. Weil auch künstlerische Parasiten, ähnlich den tierischen, dem Paradigma des Selbstzwecks folgen, scheuen sie die Einfühlung in den dominanten Organismus nicht, solange sie der Ressourcen- und Materialfindung dient. Diese anfängliche Affirmation kann jedoch zu einer destruktiven Kraft werden, die die Blindstellen des Organismus besetzt und seine Stabilität ins Wanken bringt.
2015 erhielt der kanadische Künstler Joshua Schwebel ein Residenzstipendium mit dem es ihm möglich wurde ein Projekt im Künstlerhaus Bethanien in Berlin zu realisieren. Das einjährige Stipendium stattete Schwebel mit Räumlichkeiten und Geld aus, welche zur Recherche und Honorierung seiner künstlerischen Tätigkeit dienen sollten. Trotz vehementer Abwehr der beherbergenden Institution entstand die Arbeit Subsidy (dt: Zuschuss), die darin bestand die Arbeit der unbezahlten Praktikant*innen zu vergüten und die Verrichtung ihrer regulären Tätigkeiten in den Ausstellungsraum zu verlagern. Die unsichtbare und (selbst-)ausbeuterische Arbeit, die die meisten Kunstausstellungen überhaupt möglich macht, wurde so sowohl für die Besucher*innen, als auch für die Institution selbst sichtbar gemacht.
Man könnte diese Praxis auch interventionistisch nennen, nur wäre sie ohne die Zuwendung und Partizipation an den im Kunstsystem üblichen Residenzprogrammen wohl nicht möglich gewesen. Künstlerischer Parasitismus ist weder an einer solchen moralischen Fragestellung interessiert, noch ist er apolitisch. Er nähert sich der kapitalistischen Verwertungsmaschine, die auch das Kunstsystem regiert, an – para- aus dem lateinischen neben, bei – und entzieht ihr gleichzeitig einer ihrer wichtigsten Ressourcen: ihre (Be-)Deutungshoheit. Die Radikalität des künstlerischen Parasitismus besteht darin die Dilemmata künstlerisch-politischen Eingriffs nicht nur auszuhalten, sondern sich von ihnen zu ernähren und sich der eigenen Involviertheit kritisch anzunehmen.
Im Rahmen des Project Space Festival Berlin 2019 wird Joshua Schwebel die erste Pilotfolge einer Reality TV Show produzieren, in der die Bedingungen und Schwierigkeiten der Gründung und Etablierung öffentlicher Kunsträume ersichtlich werden sollen. Die (Selbst-)Prekarisierung derer, die sich immer noch diesem Unterfangen widmen, ihre parasitären Strategien aber auch die omnipräsente Gefahr des Scheiterns, beschreiben einige der möglichen Schlüsselmomente dieser Auseinandersetzung.
Wofür Kunst- und Kulturschaffende sorgen können, sind Störungen; das Aufbrechen der standardisierten Monotonien und glatten Oberflächen, die die realen Umstände künstlerischen und kulturellen Schaffens verdecken. Die offene Frage mit der die Fabel der beiden Ratten in Michel Serres' Buch der Parasit endet, ließe sich dann, zugegebenermaßen etwas optimistisch, wie folgt beantworten: Erst kommt die Unordnung, dann eine neue, andere Ordnung.
_________
Illustration Credits:
CC karoline achilles, 2019
ig: @achillescartoons
Feben Amara hat Kunst-, Kulturwissenschaft und Germanistik studiert. Ihre Forschung umkreist die Wissensformationen postkolonialer Theorie, Transkulturalität und Resistance Studies. Im Rahmen des Project Space Festival Berlin 2019 arbeitet sie als Autorin und Redakteurin an textuellen Beiträgen.
Dieser Beitrag ist zuvor in der Arts of the Working Class # 6 : Art of Darkness erschienen.